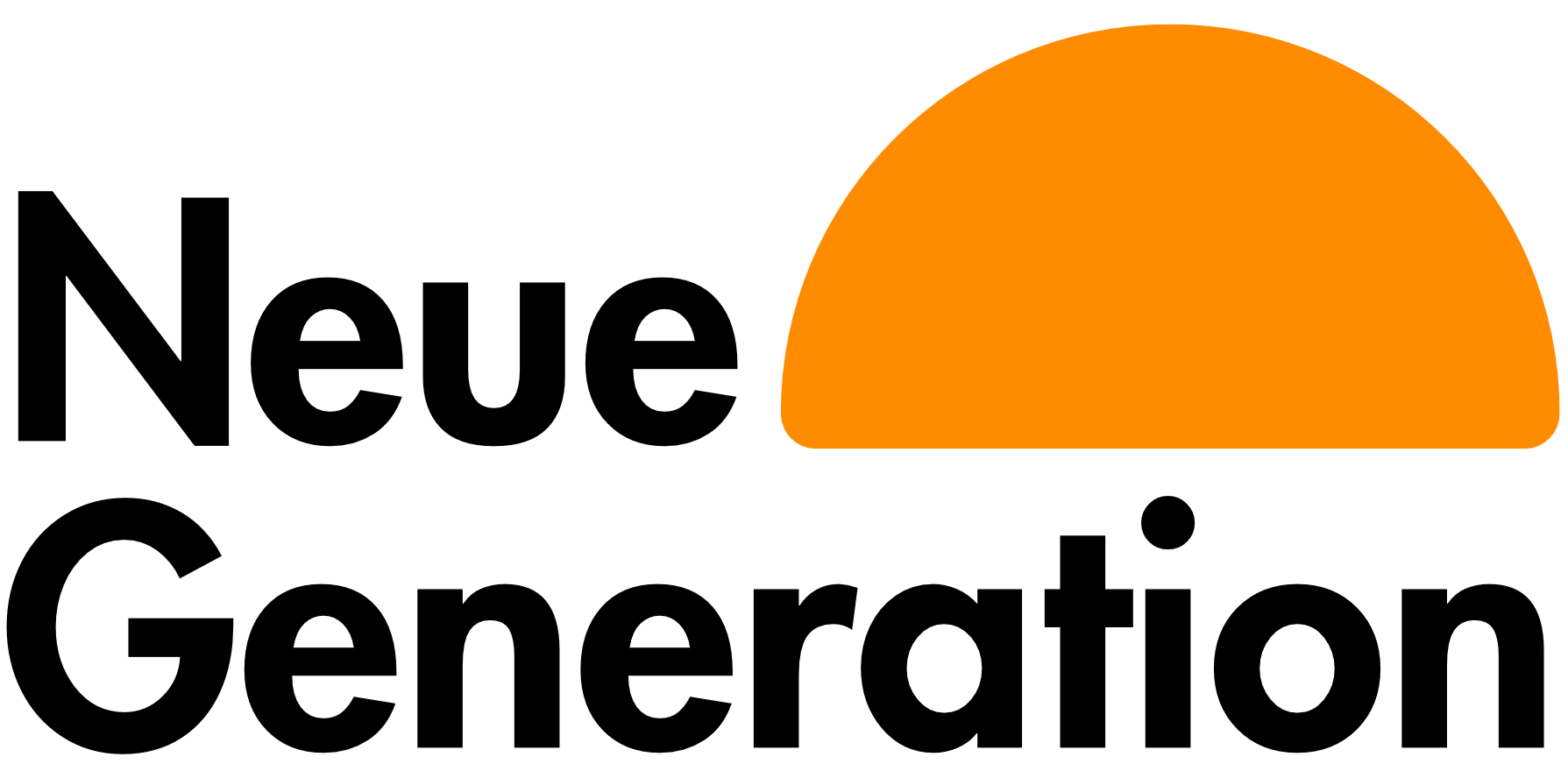Klima & Demokratiekrise
Demokratie in der Klimakrise – Warum sich der Mehrheitswille durchsetzen muss
Demokratie bedeutet: Die Interessen der Bevölkerung werden durch politische Prozesse berücksichtigt und repräsentiert. In Umfragen sprechen sich große Mehrheiten für stärkeren Klimaschutz aus. Eine Studie des Umweltbundesamts aus dem Jahr 2023 ergab, dass 79 % der Deutschen eine ambitioniertere Klimapolitik befürworten – selbst wenn damit Einschränkungen oder Kosten verbunden sind. Besonders hoch ist die Zustimmung bei jungen Menschen, die die Folgen der Erderhitzung am stärksten spüren werden.
Trotz dieser Mehrheiten werden zentrale klimapolitische Maßnahmen entweder verschleppt, verwässert oder ganz verhindert. Emissionsziele werden nicht eingehalten, fossile Subventionen bleiben bestehen, neue Autobahnen und LNG-Terminals werden gebaut. Dabei ist Deutschland mitverantwortlich für rund 2 % der weltweiten CO₂-Emissionen – historisch gesehen deutlich mehr –, gehört aber zu den Ländern, die am meisten vom globalen Wohlstand profitiert haben. Eine Vorreiterrolle wäre angebracht, bleibt aber aus.
Ein zentraler Grund für diese Diskrepanz liegt im Einfluss wirtschaftlicher Interessen auf politische Prozesse. Lobbygruppen aus Industrie, Energie, Bau und Verkehr haben einen privilegierten Zugang zu Ministerien und Abgeordneten. Während sich Umweltverbände häufig mit symbolischen Anhörungen oder marginalen Budgets zufriedengeben müssen, verfügen Wirtschaftsverbände über professionelle Lobbynetzwerke, finanzstarke Thinktanks und enge Verbindungen zu Parteien und Medienhäusern.
Ein Beispiel: Die deutsche Autolobby war maßgeblich daran beteiligt, ambitionierte EU-Vorgaben zur CO₂-Reduktion bei Neuwagen zu entschärfen. Auch das Gebäudeenergiegesetz („Heizungsgesetz“) wurde unter massivem Lobbydruck aufgeweicht – mit tatkräftiger Unterstützung von Interessenvertreter*innen aus der Immobilienbranche und politischen Akteuren wie FDP-Politiker Frank Schäffler, der enge Kontakte zu der Lobbyorganisation Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) unterhält.
Diese Einflussnahme ist nicht illegal – aber ungerecht. Der sogenannte Drehtüreffekt, bei dem ehemalige Minister*innen oder hohe Beamt*innen in die Wirtschaft wechseln (oder umgekehrt), verstärkt diese Strukturen. Dadurch entstehen Netzwerke, die politische Entscheidungen maßgeblich prägen – oft im Sinne von Status quo und Kapitalinteressen, selten im Sinne radikaler Veränderungen oder sozial-ökologischer Gerechtigkeit.
Ein weiterer Aspekt der Demokratiekrise ist strukturell: Parlamente und politische Entscheidungsträger*innen repräsentieren nicht alle gesellschaftlichen Gruppen gleich stark. Studien zeigen, dass Menschen mit geringem Einkommen, junge Menschen und Menschen mit Migrationsgeschichte in politischen Institutionen deutlich unterrepräsentiert sind. Auch künftige Generationen – die von der Klimakrise massiv betroffen sein werden – haben keine Stimme.
Gleichzeitig nehmen narrative Verzerrungen Einfluss: Klimaschutz wird oft als Belastung dargestellt – für die Wirtschaft, den Mittelstand oder die „kleinen Leute“. Der mediale Diskurs über Klimapolitik folgt häufig wirtschaftsnahen Frames: etwa der Idee, dass der Schutz unserer Lebensgrundlagen Arbeitsplätze gefährdet oder Energie unbezahlbar macht. Diese Narrative überdecken strukturelle Ungerechtigkeiten und verschieben die Verantwortung vom politischen System auf das individuelle Konsumverhalten.
Das Ergebnis: Obwohl die wissenschaftliche und gesellschaftliche Lage dringliches Handeln erfordert, werden politische Entscheidungen weiterhin von kurzfristigen Wirtschaftsinteressen dominiert – und nicht vom langfristigen Gemeinwohl.
Hinzu kommt: Die Klimakrise selbst verschärft die Demokratiekrise. Denn je drastischer die Auswirkungen, etwa durch Hitzewellen, Flutkatastrophen oder Versorgungsengpässe, desto größer der Druck auf politische Systeme. In solchen Krisensituationen steigt die Wahrscheinlichkeit autoritärer Maßnahmen: Notstandsgesetze, Einschränkung von Grundrechten, Kontrolle über Medien und Zivilgesellschaft.
Die gute Nachricht: Demokratie ist kein starres System, sondern sie lässt sich weiterentwickeln. Um die Kluft zwischen Anspruch und Realität zu verringern, braucht es demokratische Reformen – ein Update unseres Regierungssystems.
Gesellschaftsräte und andere deliberative Demokratie Formate sind ein solches Update. Im Parlament der Menschen finden die Diskussionen statt, die unsere Gesellschaft führen muss: über Korruption, Machtmissbrauch, Klimakrise und vieles mehr. Die Neue Generation kämpft dafür, dass Gesellschaftsräte in unserer Demokratie ein festes Mitspracherecht bekommen. Wir wollen keine bloße Show, in dem Bürger*innen Beschlüsse fassen, die dann von der Politik ignoriert werden, sondern einflussreiche Entscheidungen, die die Politik legislativ binden – einen Gesellschaftsrat als dritte Kammer neben Bundestag und Bundesrat.
Das stärkt nicht nur das Vertrauen in demokratische Prozesse, sondern ermöglicht auch eine gerechtere Klimapolitik, die alle Menschen mit einbezieht. Denn der Wandel, den die Klimakrise verlangt, ist tiefgreifend – und nur dann legitimierbar, wenn er demokratisch getragen wird.
Die Klimakrise legt schonungslos offen, wo unsere politischen Systeme versagen: bei der Durchsetzung des Gemeinwohls, der Begrenzung wirtschaftlicher Macht und der Einbindung der Bevölkerung in zentrale Zukunftsfragen. Wenn Demokratien ihrem eigenen Anspruch gerecht werden wollen, müssen sie sich erneuern.Klimagerechtigkeit braucht demokratische Gerechtigkeit. Nur wenn alle Stimmen gehört, alle Interessen ernst genommen und ungleiche Machtverhältnisse abgebaut werden, kann eine zukunftsfähige Politik entstehen. Die Frage ist also nicht nur: Wie schützen wir unsere Lebensgrundlagen? Sondern auch: Wie schützen wir die Demokratie – damit sie unsere Lebensgrundlagen schützen kann?